𝟏𝟏 | 𝐀𝐮𝐬 𝐝𝐞𝐧 𝐀𝐬𝐜𝐡𝐞𝐧
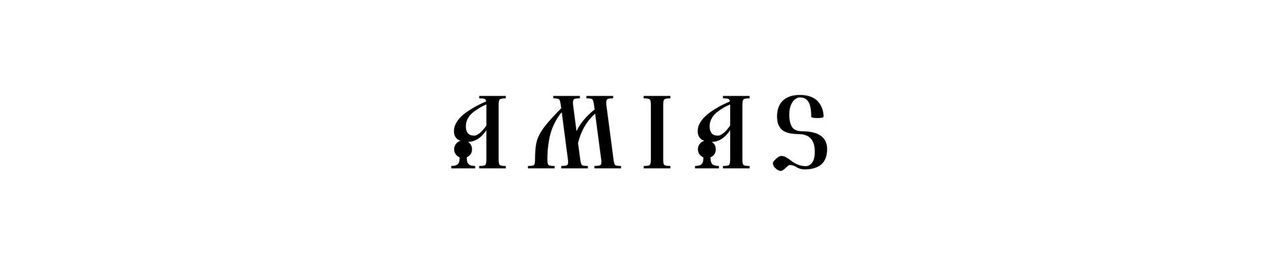
✥ ✥ ✥

» Und als die Welt drohte von Dunkelheit verschluckt zu werden, brachte Ael das Licht «
– aus Le Garié. Das heilige Buch der Aeliten
ALS KIND hatte Amias einmal eine Freundin im Palast, die nicht bloß durch Buchstaben auf vergilbtem Papier zu ihm sprach.
Tatsächlich konnte sie überhaupt nicht schreiben oder lesen, wusste dafür aber derart geschickt mit Reinigungsmitteln umzugehen, dass sie eines seiner Bücher vor der Verunstaltung bewahrt hatte. Oder sein Hemd vor einem hässlichen Blutfleck. Für beides war sein Bruder Gérin verantwortlich gewesen.
Man rief sie Mélisande, wie eine große Ahnin der Tenvals; ein sehr hoheitsvoller Name für eine niedere Dienerin. Besonders nobel sah das spindeldürre Mädchen mit den vielen aschigen Sommersprossen auch nicht aus, dessen Hände bereits unter den ätzenden Stoffen fahl und rau geworden waren. Wie Sandpapier fühlten sie sich an, wenn sie Amias' Finger ergriffen. Ihr Akzent war der hüpfende und genuschelte des einfachen Volkes im Umland und ihr Lächeln durch die kleine Zahnlücke ehrlich, breit und offen, ohne jede Geziertheit.
Doch genau darin sah Amias ihre Verbindung: Auch er trug den Namen großer Imperatoren und war doch nichts als ein unliebsamer Gast in ihrem Haus. Ein Kuckuckskind zwischen Adlern geschlüpft. Nur ihrer Missachtung verdankte er, nicht aus dem Nest geworfen zu werden.
Mélisande wusste immer die besten Verstecke und Spiele. Vermutlich kannte Amias noch nicht einmal die Hälfte davon, als diese Freundschaft ein Ende fand.
Gérin beschmutzte sie mit seinen widerlich obszönen Witzen, sobald er davon erfuhr. Amias wehrte sich, auch wenn er das Gesagte meistens nicht ganz verstand – und die Strafe dafür erhielt sie.
Was genau geschah, würde er nie erfahren. Doch als er Mélisande das letzte Mal sah, zierte ihren spitzen Wangenknochen ein dunkler Bluterguss. Ihre grauen Augen waren getötet und glasig.
Erschrocken streckte er seine Hand aus, obwohl er nicht gut darin war, Zerstörtes wieder heil zu machen. Das hier überstieg jedoch selbst Mélisandes fast magische Kräfte, hatte sich der Fleck derart tief in ihre zarte Freundschaft und ihre Seele gefressen, dass nichts der Welt ihn wieder bereinigen konnte.
Sie schlug seine Finger zur Seite. „Lasst mich. Noch nicht genug gespielt, Hoheit?"
„Ich will doch nur ... helfen. Wie ... wie Freunde", presste er irgendwann ungelenk aus seinem viel zu lange stummen Mund.
„Wie sind keine Freunde."
„Aber–" In diesem kleinen Wort verbargen sich all die geteilten Geheimnisse und das Lachen, die Amias sich anders nicht erklären konnte. „Wir sind gleich."
„Wir sind nicht gleich", zischte sie, mit dem Handrücken über ihr Gesicht wischend, als wolle sie unsichtbaren Schmutz entfernen. „Egal wie sehr dich deine Familie hasst, kleiner Prinz, du bist immer noch einer von denen und findest dir jemanden, der das Blut aus deinen Kleidern wäscht."
Danach hatte Amias sie nie wieder gesehen und nie erfahren, wohin sie den Palast verlassen hatte.
Natürlich war ihm immer klar gewesen, dass sie recht hatte. Der Gedanke, dass sie wahrhaftig gleich sein könnten, war lächerlich – niemand war wie Amias. Eben deshalb sehnte er sich so danach, zu irgendetwas oder jemandem zu gehören.
Seit er in Velija war, verstand er ihre Worte aber vermutlich zum allerersten Mal in ihrem ganzen Ausmaß. Hier empfingen ihn Zar und Zarin sogar mit den Kronen auf ihren Häuptern und war in ihrem Speisesaal erwünscht, während er in Ebrenis an den schlechten Tagen des Imperators selbst für die Tafel der Garde und Würdenträger zu niedrig gewesen wäre.
Seine Gästezimmer im Roten Palast waren einladender und größer als alles, was ihm Blancandrin zu Hause zugestanden hätte. Nicht, dass er sich viel aus Luxus gemacht hätte, doch Amias kam nicht umhin, über die Kunstfertigkeit jedes noch so kleinen Pinselstrichs oder die Kurve eines Möbelstücks verzückt zu sein, wenn er zwischen ihnen erwachte.
Und durch all das konnte er sich bewegen, ohne Rüge, ohne Getuschel in seinem Rücken.
Der Weg in die Bibliothek war ein kleines Abenteuer. Amias wusste, dass das nicht alleine seinen jüngsten Verletzungen geschuldet war. Sie waren nicht mehr als Auslöser für ein tiefer sitzendes, älteres Problem; die Schwäche, die ihn sein Leben lang verfolgte, ihn manchmal ans Bett fesselte und ihm das Bewusstsein raubte.
„Die Schwäche des unreinen Blutes", hatte es einer der Ärzte genannt. „Die Magie scheint sich nicht manifestiert zu haben, aber ihre Dunkelheit hat Schatten hinterlassen."
Vielleicht waren es letztlich diese Unzulänglichkeiten, die Blancandrin nicht über Amias' Herkunft hinwegsehen ließen.
Trotz der Unterstützung der Lakaien erreichte der Prinz die ausschweifenden Räumlichkeiten atemlos, mit schwirrendem Kopf und am ganzen Körper zitternd. Doch alleine der Duft der Seiten und diese Ruhe schienen ihm wie Balsam für seine Seele. Die Leder- und Stoffeinbände unter seinen Fingern belebten seinen erschöpften Geist wieder, erinnerten ihn in ihrer Vielzahl daran, dass man hier mehr als nur ein Leben zubringen hätte können.
„Wie ich sehe, geht es Euch schon besser?", die sanfte Stimme der Zesarewna war eine harsche Unterbrechung der fast andächtigen Stille; ein Eindringen in ein Heiligtum.
Amias brachte ein zaghaftes Nicken zustande, obwohl es eine glatte Lüge war.
„Ein Besuch in unserem Bad und Ihr werdet noch vor Eurer Abreise völlig genesen."
Das, was die Zarentochter so schlicht als „Bad" bezeichnete, war ein ganzer Komplex innerhalb des Palastes, der wohl selbst die edelsten Badehäuser in der Stadt mit all ihren Banjas und Becken hätte vor Neid erblassen lassen. Diesen Teil der velischen Kultur würde er vermutlich zu Hause auch vermissen.
Sie bemerkte das Buch in seinen Händen. „Ah, Sklaven des Krieges. Eine hervorragende Wahl", bemerkte sie wohlwollend. „Erst lebte er bloß in ihren Waffen, dann zog er in ihre Heime und Herzen ein."
Verständnislos blinzelnd sah Amias sie an, bis ihm dämmerte, dass Zina das Werk über den ersten finienisch-velischen Krieg zitierte.
„Und blieb dort, selbst als alles Blut längst vergossen war", beendete er es kaum hörbar.
Gäbe es nur ein Buch in Agvila oder gar auf der ganzen Welt, das die Schrecken des Krieges auf Papier bannen sollte, dann hätte es dieses sein müssen.
Der Schatten eines Lächelns huschte über Zinas Gesicht. „Ihr kennt es also bereits?"
„Natürlich. Wie hätte ich es auch nicht lesen können?" Schließlich handelte es ich um ein Meisterwerk.
„Ich habe es vor Jahren gelesen und noch heute verfolgt mich der Tod des Protagonisten. Meint Ihr, er hatte je eine Chance auf ein anderes Ende? Ein glücklicheres?"
Amias schüttelte den Kopf. „Nein."
Diese stumpfe Bekundung schien Zinaïda zurückzustoßen, als wäre es eine Ohrfeige gewesen.
„Ich meine ...", mit wachsender Aufregung, die durch sein Blut schoss und mit jedem seiner übereinander stolpernden Worte wuchs, fuhr er fort. „Ich meine, das war doch das, was die Geschichte uns sagen sollte. Dass am Ende des Krieges immer nur der Tod steht. Der des einfachen Soldaten wie der der Herrschenden. Der der Kultur und der der Seele. Seine einzigen Früchte sind Zerstörung."
Schon als Amias die stoßweise und atemlos seine Lippen verlassenden Sätze beendet hatte, schämte er sich ihrer und der Freude, die er dabei empfand. Er benahm sich wie ein ausgehungerter Bettler, dem man Brotkrumen hingeworfen hatte.
Und doch – das Gefühl konnte das stille Glück mit jemandem diese Gedanken teilen zu können, nicht ersticken.
Im Übrigen zeigte Zinaïda nicht den geringsten Spott. „Es lässt einen nicht los, nicht wahr? Nicht nur die Worte. Die Wahrheit dahinter."
Wieder nickte Amias, nun wieder zögerlicher, unsicher.
Ihr Blick wanderte über die schier endlosen Reihen von Büchern hinweg. „Die Vorstellung, dass es wieder so sein könnte ..."
Nur halb geäußert endete der Gedanke in einem Seufzer, der im Raum zwischen ihnen hängen blieb. Lang und schwer und drückend. In der Stille gewannen ihre Augen, die nun wieder auf ihn gerichtet waren, eine merkwürdige Intensität, die ihn noch mehr als sonst seinen eigenen Blick senken lassen wollte.
Irgendetwas sagte Amias, dass Zinaïda nicht selbst der Einfall gekommen war, ihn hier aufzusuchen.
Das ist ein Versöhnungsversuch. Die Mundwinkel des Prinzen sanken. Und ein verzweifelter noch dazu, wenn der Zar dafür seine Heilige ins Gefecht schickt.
Nur was genau wollten sie damit erreichen? Eine Bestätigung für weitere Jahre des Friedens, die Amias selbst, wenn er wollte, nicht geben konnte?
„Verzeiht, das ist unangebracht", durchbrach sie irgendwann selbst das Schweigen, das nichts mehr mit dem heilsamen zu tun hatte, das Amias von der Bibliothek kannte, und ließ sich zu seinem Erstaunen kopfschüttelnd am Boden nieder, das Bücherregal finiencischer Klassiker in ihrem Rücken.
Dort wo sie das dunkle Holz berührte, genau zwischen ihren Schulterblättern, verschwand Die Verdammten. Selbst in dieser Geste lag etwas merkwürdig Elegantes, obwohl das letzte, was der Prinz von der Zesarewna erwartet hätte, war, sie jemals mit angezogenen Knien und blütenweißem Kleid irgendwo auf dem Boden sitzen zu sehen. So sauber es hier auch sein mochte.
In Ebrenis verschwand er auch immer genauso zwischen den Regalen und las.
„Darf ich offen sprechen?", fragte Zina leise und irgendetwas daran ließ Amias diese Situation unerträglich werden, wie er so über ihr hochragte, und er setzte sich in seiner gewohnten Pose im Schneidersitz zu ihr, alleine um sie zu überwinden.
„Natürlich."
Zina biss sich auf die Unterlippe, als wollte ein Teil von ihr sie an den folgenden Worten hindern, doch er siegte nicht. „Manchmal würde ich lieber hier leben. Nur zwischen Papier und Worten. Dort ist jedes vergossene Blut nur Tinte."
Unbehaglich rutschte Amias auf seinem Platz hin und her. Was sollte er darauf denn auch antworten? Bei Ael, der einzige Mensch, der ihm nur ansatzweise seine Gefühle derart offenbarte, war Pinabel und bei ihm war das nie in einer solchen Verletzlichkeit geschehen.
Allerdings musste er doch etwas sagen, oder nicht?
Wieder nahm Zina ihm diese steigende Last. „Ich weiß, die Frage, die ich jetzt stellen werde, ist denkbar ungehörig und kindisch und naiv, aber – warum muss zwischen dem Norden und Süden diese Feindschaft bestehen?"
„Aber es ist doch keine–", setzte Amias instinktiv an.
Die Augenbraue der Zarewna schoss in die Höhe und sie bedachte ihn mit einem spöttischen Blick, den er ihr nicht zugetraut hätte. „Ach nein? Weil wir es als Bruderschaft bezeichnen, ist es eine? Ich kann meinen aspravischen Schäferhund so oft Berglöwen nennen, wie ich möchte, er wird dadurch keiner werden."
Wo bin ich hier bloß gelandet? Ein solches Gespräch sollte – durfte – mit Sicherheit nicht stattfinden.
Mit einem erneuten Seufzen verschwand das herausfordernde Blitzen aus Zinaïdas blauen Augen. „Es könnte doch alles so viel einfacher sein."
„Nichts mit langer Geschichte ist je einfach", widersprach Amias vorsichtig, und die Agvilas war es, geprägt von zu vielen Schlachten im Feld oder in Verhandlungsräumen. Jahrhunderte zerstörter Leben und gekränkter Gemüter schrien immer wieder nach neuer Rache.
„Über die Kontinente hinweg sind sich Dynastien in Bündnis, Freundschaft und Ehe verbunden – selbst ehemalige Feinde."
„Aber die Religion", warf Amias ein. Mehr musste er auch nicht sagen, denn jeder kannte diese Hürde, die eine Verbindung der Dynastien in vielen Fällen unmöglich gemacht hatte. Eine Ehe in Kresniks und Vesinas Namen besaß keinen Wert in Finience. Für lange Zeiten wäre es gar eine unsühnbare Schande gewesen, einem falschen Gott, der überdies Vater der Sünde der Magie sein sollte, eine Existenzmöglichkeit einzuräumen.
Zina zuckte die Schultern. „Unsere Götter dulden andere neben sich. Gebete an Ael beleidigen sie nicht."
Und dennoch wäre auch den wenigsten Veliern eingefallen, eines zu sprechen, bedachte man die paar weniger wohlwollenden Priesterorden der Aeliten, die nicht dem liberaleren Zeitgeist gefolgt waren, sondern ihren Hass auf den „barbarischen Aberglauben" laut genug von der Kanzel schrien, dass man es in Velija noch hören konnte.
Kresnik und Ael konnten nie nebeneinander existieren und selbst, wenn jemand gewagte hätte, diesen tiefen Graben zu überwinden, welche Folge hätte es als Misstrauen und Ablehnung der anderen? Denn unter diesen Umständen musste eine solche Tat Verrat sein.
Just in diesem Moment fügte sie hinzu: „Für Séraphin und Tomila war es ebenso möglich."
Über Prince Séraphin de Tenval, der vor über hundert Jahren die Zesarewna geheiratet hatte, wurde allerdings ebenso ungern gesprochen wie über Tomila Chervenkova, die Cousine Gerasims, die Blancandrin seinen jüngsten Sohn geschenkt hatte. Ihr Tod bei der Geburt schien die Welt geradezu aufatmen zu lassen, weil sie somit nach diesem kleinen politischen Zugeständnis zur Sicherung des Friedens nun doch wieder zu alter Ordnung zurückkehren konnte.
„Letztlich geht es doch nie um den Willen der Götter, sondern um den der Menschen", sprach Amias aus, was Zinaïda denken musste.
„Morgen wird dieser Wille unserer sein und wofür werden wir uns dann entscheiden: Wieder Sklaven des Krieges zu werden oder endlich wahrhaftigen Frieden?", fragte sie leise und berührte mit ihren Fingerspitzen das Buch in seiner Hand. Doch so sanft und bedacht ihre Stimme war, so hell leuchtete auch das Feuer in ihren Augen.
Am liebsten hätte Amias laut aufgelacht. Wem auch die Zukunft gehörte; er wäre es nicht. Doch als ihm klar wurde, wovon Zinaïda sprach, verschlug es ihm jeden Anflug von bitterem Humor. Séraphin und Zarin Dubravka ...
Sein Herz pochte unnatürlich laut in seinen Ohren. War das etwa seine Chance? Nicht bloß auf eine Rache, die noch so viel schmerzhafter wäre als ein bisschen verlorenes Geld, sondern auf Flucht aus der grausamen Gnade anderer. Auf ein bisschen Macht über sein eigenes Schicksal. Auf einen Platz in der Geschichte, die er besser verstand als seine Brüder.
„Frieden", hauchte er und besiegelte damit ihren Pakt, auch, wenn er tief in seinem Inneren nicht glauben konnte, diese Zukunft noch zu erleben.
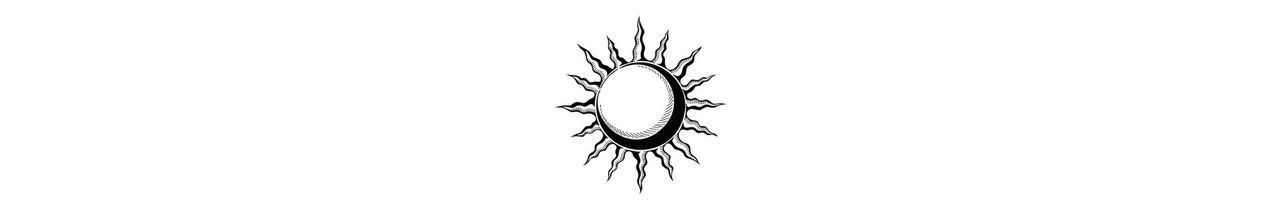
Als er die Landschaft vor seinem Fenster vorbeirauschen sah, empfand Amias den zartesten Stich von Heimweh in seinem Herzen. Nicht jedoch für diese, der der Zug sich wie eine eiserne Schlange entgegenwand und damit eine frische Schneise durch Agvila schlug – durch Felder und Wälder, über Berge und Flüsse.
Ironischerweise zog es ihn zurück nach Velija, wo er zumindest einen Ansatz dessen hatte kosten können, was man ihm zu Hause verwehrte. Und etwas sagte ihm, dass nach seinem Streit mit dem Imperator all die Spielereien vielleicht ein Ende gefunden hätte, dieser alberne Tanz um den Tod.
Amias' Hand ballte sich zur Faust, eben diese, in der noch kurz zuvor das rote Band geruht hatte.
„Geben Sie es Kapralitsa Svarozhina", hatte er Khomiakov gesagt, der sich bei der Verabschiedung so tief verneigt hatte, dass er beinahe den Boden geküsst hätte.
Der Höfling hatte noch irgendeine Antwort gestammelt, doch da war Amias bereits seinem Vater, dicht umgeben von ihrer eigenen Leibgarde, in den Zug gefolgt.
Jetzt saß der Prinz hier am Fenster und verspürte in dem luxuriös aussehenden, aber wenig bequemen Abteil die letzten Stunden seines Lebens verrinnen.
Doch zum ersten Mal verspürte er den Drang, es zu packen und mit Zähnen und Klauen zu verteidigen, wenn es nötig war. In seinem Inneren schwelte ein dunkles, eisiges Feuer.
Er war kein Niemand mehr. Man hatte ihn töten wollen. Und alle drei Male hatte er Kugeln und Magie überlebt. Amias gedachte nicht, diesen Triumph jetzt irgendeinem drittklassigen Meuchelmörder seines Vaters zu überlassen.
Vielleicht war es ein größerer Fehler gewesen, ihn mitzunehmen als der Imperator bisher geahnt hatte. Jedenfalls wäre er wenig entzückt, wenn er wüsste, dass sein Sohn hinter seinem Rücken mit der Ketzerheiligen ihrer Nachbarn ein Bündnis geschlossen hatte.
Draußen hoben einige Bauern unter der Mittagssonne den Kopf und bewunderten dieses Biest, das dampfend an ihnen vorbeischnaufte. Den Blick eines blonden Mädchens meinte Amias noch lange auf sich zu spüren, auch, wenn er nicht wusste, ob sie ihn hinter dem Glas überhaupt sehen konnte oder bloß die gespiegelten Sonnenstrahlen.
Vielleicht träumte sie in diesem Moment davon, an seiner Stelle zu sitzen, auf diesen befremdlichen Erddrachen, der seit einem Jahr ihre Heimat durchquerte, zu springen und sich von ihm in die Fremde tragen zu lassen, die für sie noch aufregend und endlos am Horizont wartete.
Allerdings gab es da rein gar nichts Beneidenswertes, dachte Amias. Er würde diese Fahrt nutzen, um seine eigenen Zähne gegen die der hungrigen Wölfe, die zu Hause lauerten, zu schärfen.
Aus seiner Tasche fischte er die Taschenuhr, die sich in seinen Fingern merkwürdig schwer anfühlte, heiß und kühl zugleich. Bisher hatte er ihr Geheimnis noch nicht zu entschlüsseln vermocht, doch er konnte es spüren, riechen, sogar schmecken; ein metallischer Saum wie von Blut, der sich auf seine Zunge legte. Es lag wie ein lockender Ruf in seinen wirren Träumen.
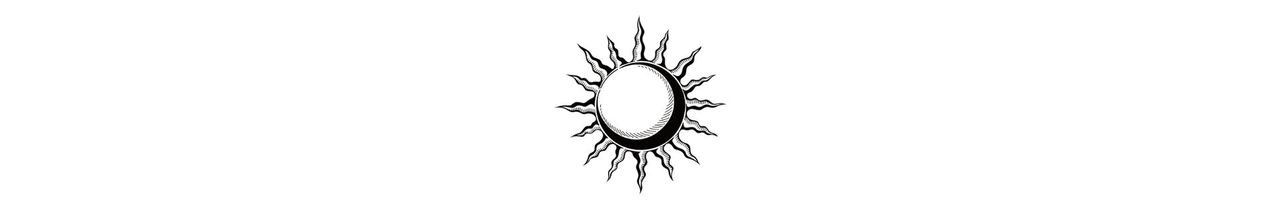
„Halt dich gerade. Du repräsentierst jetzt dieses Land", erinnerte Blancandrin Amias streng, während ein Lakai ihm half, seine Uniform anzulegen. „Zumindest für einen Moment."
Selbst nach seiner Zeit in Velija hatte er sich nicht an den schwarzen Stoff mit der goldenen Bestickung und unzähligen Verzierungen gewöhnen können und noch weniger an den dekorativen Säbel, den man ihm um die Hüfte hängte.
Obwohl nichts davon seine kränkliche Blässe und seinen schmächtigen Körper kaschieren konnte, verlieh diese Kleidung seiner unzufriedenen Miene eine erhabene Strenge, seinem Blick Autorität und der Erschöpfung etwas Heroisches. So sah er beinahe aus wie ein tatsächlicher Prinz, eine Person von Wichtigkeit und Macht, der Sohn seines Vaters.
Eine Lüge, die in dem Augenblick zerbrechen würde, da sie den Palast erreichten. Ihm so nahe weckte diese Aussicht wieder die alte Angst. Dort bist du immer noch ein Nichts. Hilflos.
„Weißt du, Amias, deine Worte in Velija haben mir zu denken gegeben." Der Imperator verscheuchte die Diener mit einer nachlässigen Geste und zupfte eine letzte, unsichtbare Falte an Amias' Kleidung zurecht. „Du hast völlig recht. Ich habe diesen Unsinn viel zu lange geduldet. Das alles hat jetzt sein Ende."
„Ja, Eure Majestät", antwortete Amias stumpf, ehe er seinem Vater mit schmerzhaft pochendem Herzen und aufsteigender Übelkeit in die Kutsche folgte. Warum jetzt? Warum nicht früher?
Ebrenis erschien Amias beinahe fremd, obwohl sich im Grunde nichts an ihrer kalten Schönheit verändert hatte. Ihre Gebäude reckten sich immer noch spitz dem Himmel zu. Die Greynne floss immer noch denselben Weg; heute in einem tiefen, schweren Meerblau.
Nur hier und da glaubte er an den Flaneuren neue modische Spielerein zu erkennen, die ihm vor seiner Abreise nicht aufgefallen waren. Allerdings sah er meist nicht richtig hin. So beständig Ebrenis war, so flatterhaft waren ihre Bewohner.
Vielleicht lag es aber auch bloß an der Lebendigkeit, in der sie sich ihm heute darbot. Ein einziges Gewusel aus rufenden, winkenden, strahlenden Menschen, die den gemächlichen Weg ihrer Kutsche mit Blumen bestreuten, um den Imperator und seinen Sohn zurück zu empfangen.
Amias meinte in dem Gefährt zu ersticken. Die Präsenz seines Vaters, so dicht neben ihm, raubte ihm den Atem, die Massen draußen erdrückten ihn geradezu und jedes Holpern über das Pflaster jagte neuen Schmerz durch seine Wunden. Und das alles nur, um hinter verschlossenen Türen sein letztes Urteil zu erhalten.
Noch bevor sie den Palast erreicht hatten, wo seine Geschwister, Höflinge und Pinabel bereitstanden, riss Amias kurzentschlossen die Tür auf und sprang hinaus, bevor der Kutscher hätte anhalten können.
„Amias, untersteh–"
Was auch immer ihm der Imperator nachrief, er hörte es nicht mehr. In seinem Puls pochte das unbändige Verlangen nach Flucht. Vor seinem Vater, diesen Massen, vor der gesamten Welt.
Bloß gab es nichts wohin er wirklich hätte fliehen können.
Amias' Beine trugen ihn zur Kathedrale Seint Ael ha Seinte Ignése, die sich unweit an den Palast schmiegte, um die ungebrochene Ehe zwischen Kirche und Herrscherhaus zu verkünden. Als höchstes Gebäude ganz Ebrenis reckte sie sich in den Himmel; ein Monument des ewigen Versuchs, ihn irgendwann zu erreichen.
Heute würde sie wohl ausnahmsweise verwaist sein.
Als der Prinz das Tor aufriss, war ihm bereits der Schweiß ausgebrochen. Jeder seiner Muskeln schmerzte unter der Anstrengung als Mahnmal an seine unverheilten Verletzungen.
Weihrauchgeschwängerte, kühle Luft schwappte ihm entgegen und drang mit ihrem vertrauten Prickeln in seine Lungen. Den Weg bis zum Altar stolperte er mehr als dass er ging, hektisch die Uniformjacke und den Säbel von sich reißend, die ihn unter ihrer Last begraben wollten.
Atmen. Er wollte bloß wieder frei atmen.
Mit einem dumpfen Aufprall landete die Waffe vor dem Altar auf dem Stein zu den marmornen Füßen der Seinte Ignése, die sich dort vor dem Schwert Aels ihren eigenen magischen Flammen übergab. Selbst verschlungen von diesem Feuer, das im Licht der Kerzen beinahe real schien, verriet ihr Gesicht nicht den geringsten Schmerz. Ihr rätselhafter Blick, irgendwo gefangen zwischen Stolz und Verzückung – er richtete über jene, die er traf, und schaute doch göttliche Wunder, während sie ihre Arme Ael, dessen Abbild die Kuppel über ihr zierte, entgegenstreckte.
Die reale Märtyrerin hatte ihn längst erreicht, während die Hände der Statue und die des Gemäldes sich hier niemals treffen würden.
„Warum lebe ich?!", der Schrei kostete Amias seine letzten Kräfte und zwang ihn in die Knie. Außer dem donnernden Widerhall, dem die Gemäuer auf ihn zurückwarfen, würde er keine Antwort erhalten.
Wenn die Heiligen sprachen, dann nicht zu ihm. Selbst, wenn er Aels Nachkomme war.
Doch damit täuschte er sich.
„Amias!", donnerte eine Stimme. Nicht die de Ignèse oder Aels, sondern die seines Vaters.
So endete also seine Flucht? In seinem Fieberwahn erwartete er beinahe, dass der Imperator ihn hier vor der Statue der einzigen heiligen Magierin mit seinem eigenen Säbel aus Zorn erstechen würde, so wie er es sicherlich schon lange wollte.
Gäbe es einen passenderen Ort dafür als hier?
Stattdessen herrschte kurz Stille, dann folgten weitere Worte. Diesmal jedoch von Pinabel.
„Amias Salveor", flüsterte er ehrfürchtig.
Verwirrt wandte Amias sich zum Eingang um, doch das Sonnenlicht verwandelte die Menge dort in nichts weiter als verschwommene Silhouetten. Wie viele Menschen würden ihn jetzt so sehen? Zitternd, schwitzend und einer Ohnmacht nahe?
„Ihr könnt mich erstechen, doch meine Wunden werden nicht bluten. Ihr könnt mich verbrennen, aber meine Haut wird nicht zu Asche zerfallen. Ihr könnt mich köpfen, doch meine Lippen werden weiter Wahrheit sprechen. Ihr könnt mich töten, aber ich werde wiederkehren", zitierte der Priester Seint Aels heilige Worte. In Amias' Ohren verkamen sie zu einer ineinanderfließenden Litanei wie von fremden Zungen.
„Richten wird mich nur der Höchste von allen und ich werde vor ihn treten ohne Namen, ohne Schwert und Krone, sondern alleine mit meinem Herzen."
Zwischen den Menschen breiteten sie sich aus wie ein Lauffeuer, das die Kathedrale verschluckte.
„Das ist Glaube! Das ist ein wahrer Sohn Aels!"
Das Einzige, das der Prinz klar verstand, war dieser eine Ruf, wieder und wieder, bis er sich tief in sein Inneres gefräst hatte. „Amias Salveor! Amias Salveor!"
Amias der Retter.

„Musste das sein? Den missratenen Jungen auch noch als Friedensbringer zu stilisieren ...", fragte Blancandrin de Tenval, ohne die düstere Miene vom Nachthimmel hinter dem Fenster abzuwenden.
Er meinte, die ekstatischen Rufe immer noch zu hören. Vielleicht hatte sich die Menge auch tatsächlich noch nicht ganz verlaufen, selbst nachdem man Amias so würdevoll wie möglich in den Palast begleitet und dort kurzerhand in sein Bett verfrachtet hatte.
Mit Fieber entzog er sich geschickt jeglicher Verantwortung.
In der Greynne ertränken hätte ich ihn sollen! Aber der Imperator war nun einmal keiner der verzweifelten Lumpen, die ihre Neugeborenen dem kalten Tod im Fluss überließen. Schwach, schwach ... Ich war immer zu schwach. Er dachte an seine Élainne.
„Verzeiht, Eure Majestät, doch die Situation war äußerst Delikat. Ich befürchtete einen Skandal", setzte der Priester Pinabel behutsam an.
Es hieß im ganzen Land füllten sich die Kirchen mit Menschen, die für den Prinzen beteten, und keine Nachricht bewegte Zeitungen, Hof und Volk so sehr wie die jüngsten Ereignisse.
Und überall dieser selbe, widerliche Name ...
„Amias Salveor!", stieß Blancandrin verächtlich aus und zerknitterte das Extrablatt des Corier d'Ebrenis, das wenige Stunden nach ihrer Ankunft bereits durch die ganze Stadt geisterte. Mit ihm das völlig hirnrissige Gerücht, Amias hätte einen Schuss ins Herz überlebt, das nach seiner kleinen Szene neuen Brennstoff gefunden hatte. Selbst die besseren Zeitungen sind heutzutage nicht mehr zu gebrauchen.
Auch ohne es zu sehen, konnte er in der Stimme des Priesters hören, dass er den Kopf schüttelte.
„Eure Majestät, ich habe nur im Wohle des Staates gehandelt. Wir beide wissen, dass es durchaus Menschen gibt, die den Krieg entgegen jeder Vernunft wollen, um ihre Taschen damit zu füllen. Nach allem, was in Altingrad passiert ist, hätten sie leichtes Spiel, ganz Finience nach Blut lechzen zu lassen – ich gab ihnen einen Grund, nach Frieden zu rufen. In dieser Zeit braucht das Land, die Kirche, nichts dringender als ein wenig Hoffnung."
Mit jedem Wort spürte der Imperator mehr Zorn durch seine Adern kochen. Diese Impertinenz! Er hatte diesem kleinen Pfaffen viel zu lange freie Hand gelassen.
„Dazu hattet Ihr nicht das Recht", zischte Blancandrin, das dunkle Papier zwischen seinen Fingern zerknüllend. Bei jedem schweren Atemzug verstärkte sich das Stechen in seiner Schulter, wohl ein leidliches Mitbringsel von der desaströsen Parade. „Wir hatten eine Vereinbarung. Ihr erzieht Amias und haltet ihn dabei aus aller Öffentlichkeit fern."
In den staubigen Schatten der Bibliothek, wo er keinen Schaden anrichten konnte, wo die Welt ihn vergessen würde.
Im nächsten Augenblick hatte der Imperator seine stetig ruhige Maske bereits wieder aufgesetzt, die ihm all seine Regierungsjahre beste Dienste geleistet hatte. Nur auf seiner Stirn glänzten ein paar Schweißperlen.
„Père", fuhr Blancandrin in diplomatischem Tonfall fort, ließ sich dabei aber nicht entgehen, den Priester mit seinem Titel auch an seinen niederen Platz in der Kirche zu erinnern. So schlicht, wie das Männlein mit dem schütteren Haar und der prominenten Nase auch. „Ich habe dieses Land selbst durch die Anagantion-Krise navigiert. Mit Aufklärung und Rationalität, nicht falschen Heiligen. Es hat seine Gründe, warum wir Tote Heilige nennen und keine Lebenden. Wilder Fanatismus ist eine Waffe, die ihren eigenen Meister schon oft genug gepfählt hat."
Das schmale Gesicht des Priesters trug eines dieser wissend lächelnden Mienen zur Schau, die der Imperator am Priesterstand so innig verachtete.
„Nichts ist so wankelmütig und kurzlebig wie die Liebe des Volkes. Wen es heute feiert, hat es morgen vergessen."
______________________________
𝐀 𝐍 𝐌 𝐄 𝐑 𝐊 𝐔 𝐍 𝐆 𝐄 𝐍
Ich bin aus der Versenkung aufgetaucht! Und hoffe an dieser Oberfläche auch noch ein Weilchen zu bleiben. Zumindest hab ich wieder mal ein paar mehr Kapitel fast fertig. Vielleicht rettet Amias, der große Retter ja auch vor ewigen Update-Pausen? ;)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top