35. Kapitel
Ihr sucht eine internationale Sprache? Sie ist längst im Gebrauch: das Geld.
Otto Ernst
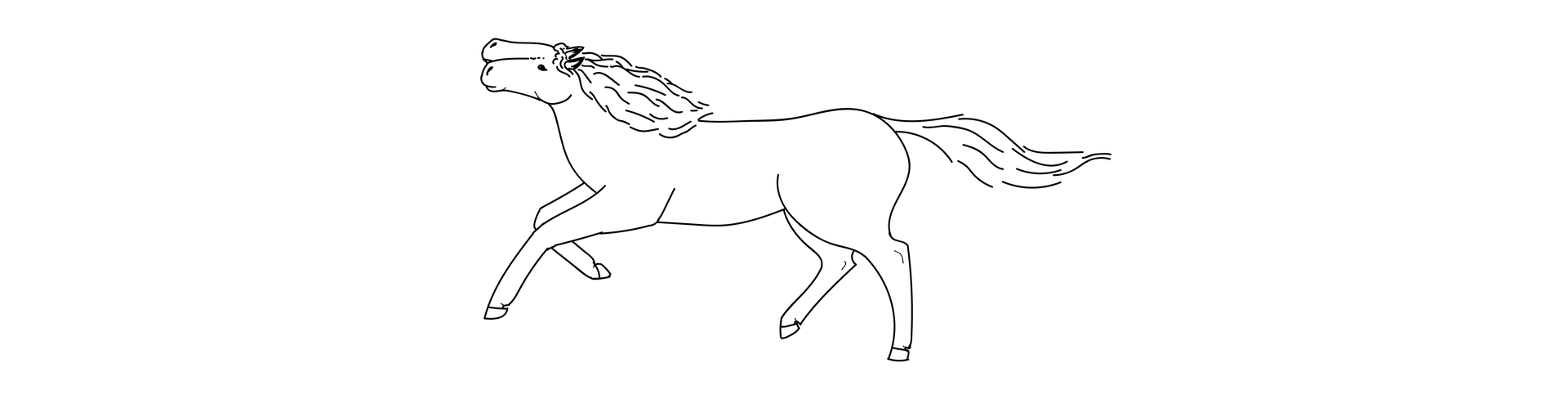
Am nächsten Morgen brachen sie im Schein der ersten Sonnenstrahlen auf. Javet hatte sich ungefähr gemerkt, wo das Dorf lag, in dem die Ohnegliederin ihm die Kleidung überlassen hatte. Sie mussten sich weiter südlich davon halten, um das Grenzland zu verlassen und tatsächlich kamen sie bald bei dem Wassergraben an, an dem auch Vegg lag.
»Wie kommen wir auf die andere Seite?«, fragte Javet. Ihnen fehlten diese Boote, mit denen die Triglaza sie entführt hatten.
Derselbe Gedanke schien Domador jedoch auf eine Idee zu bringen. Er winkte ihn hinter sich her. »Komm, wir gehen so lange weiter, bis wir Vegg sehen. Wenn das, was du von dem Überfall erzählt hast, stimmt, dann werden die Triglaza auf dieser Seite irgendwo ein Versteck mit ihren Booten haben.«
Also folgten sie dem Ufer des Grabens nach Osten. Währenddessen musterte Javet Domador nachdenklich. Er konnte nicht abstreiten, dass der Mann auf einmal nicht mehr so aggressiv und misstrauisch ihm gegenüber war wie zuvor. Besonders nach dem gestrigen Gespräch hatte er das Gefühl, dass sich etwas an ihm verändert hatte. Er war es sogar gewesen, der ihn getröstet hatte, nachdem Annie gestorben war. Nicht Sera. Woher kam dieser plötzliche Wandel?
»Domador?«, sprach er ihn nach einiger Überwindung an. »Bist du nicht mehr böse, dass Muerte wegen mir gestorben ist?«
»Er ist nicht wegen dir gestorben«, kam die Antwort von weiter vorne.
Javet hielt überrascht inne und ging dann weiter.
»Und nein, ich bin dir nicht böse.« Domador seufzte. »Du bist ein guter Junge, ganz so wie Sera es gesagt hat. Ich hätte von Anfang an auf sie hören sollen.«
»Warum hast du es dann nicht gemacht?«
»Ich hatte mir in den Kopf gesetzt, alles, was sie sagt, schlecht zu finden.« Er verstummte und es dauerte eine Weile, bis er wieder zum Reden anhob: »Bei uns in Hölle werden nur selten Kinder geboren, die ihre ersten Jahre überleben. Deswegen versuchen die Eltern für ihre Söhne möglichst früh eine Frau zu finden, die äußerlich gesund genug ist, um mit einer großen Wahrscheinlichkeit Kinder zu gebären, die lebensfähig sind. Mein Vater hat es auch so gemacht. Seine Wahl fiel auf eine Frau namens Amante.«
Javet hörte ihm aufmerksam zu. Er hätte nie gedacht, dass Domador jemals freiwillig etwas von sich selbst erzählen würde.
»Sie war sehr hübsch und so mutig... Ich habe sie über alles geliebt. Aber eines Tages zog sie mit ihrer Patrouille aus und traf an der Grenze zu Vernichtung auf eine feindliche Patrouille. Zwischen unseren Städten herrscht eigentlich Waffenstillstand und besonders wir dürfen uns nicht mit Esperar anlegen. Das ist der Bürgermeister von Vernichtung. Aber Amante hat den Anführer der Patrouille angegriffen. Sie hat ihn getötet und starb dabei selbst. Keiner hat ihr geholfen.«
Weil das zu noch mehr Blutvergießen geführt hätte, erkannte Javet voller Entsetzen.
»Sera war bei dieser Patrouille dabei. Sie hätte eingreifen können, hat es aber, wie alle anderen auch, nicht getan. Nach Amantes Tod wählte mein Vater sie als meine zukünftige Ehefrau aus. Dafür habe ich sie gehasst. Ich habe geglaubt, sie würde versuchen, Amantes Platz einzunehmen. Und erst jetzt habe ich verstanden, dass sie gar keine Schuld an Amantes Tod trägt. Sie hat so gehandelt, wie es am besten für Hölle war.«
Domador wandte sich an Javet und zögerte kurz, bevor er ihm auf die Schulter klopfte. »Ich war blind. Aber jetzt sehe ich. Und weißt du, was ich noch sehe?« Er deutete zu einem Felsen, hinter dem ein Haufen Metall glänzte. »Ein Boot der Triglaza.«
Javet war immer noch überrascht von dem plötzlichen Wandel, half dem Mann aber, das Boot umzudrehen und in das Wasser zu stoßen. Hier schien das geheime Versteck der Triglaza zu sein, denn es gab noch drei weitere Metallboote, unter denen jeweils zwei Metallstäbe lagen, deren Enden plattgedrückt waren. Javet nahm sich einen und Domador den anderen. Schnell fanden sie heraus, wie man mit ihnen das Boot durch das Wasser vorwärts schieben konnte. Da es keine Strömung wie in einem normalen Fluss gab, schafften sie es recht schnell auf die andere Seite und traten wieder an Land.
»Wir brauchen ein Pferd, wenn wir schnell vorankommen wollen«, bestimmte Domador.
»Der Fährmann, bei dem Annie und ich untergekommen sind, hatte einen Stall«, erinnerte Javet sich. »Aber ich weiß nicht, ob die Triglaza vielleicht alle Tiere getötet haben. So wie Noche...«
Domador legte ihm erneut eine Hand auf die Schulter. »Einen Versuch ist es wert. Vegg sollte doch ganz hier in der Nähe sein, oder?«
»Wenn die Bewohner dort mich sehen, werden sie mich ausfragen, wie ich überlebt habe. Und wo die anderen Gefangenen sind.« Javet presste die Lippen fest zusammen und wollte gar nicht an die enttäuschten und vielleicht wütenden Gesichter denken, die er sehen würde, wenn sie seine Antwort hörten. Die anderen Gefangenen haben keinen Willen mehr. Sie sind Sklaven. Wir sind geflohen und haben sie einfach zurückgelassen...
»Deswegen gehe ich alleine«, sagte Domador. »Du bleibst hier und wartest.«
Sein Ton duldete keinen Widerspruch und so blieb Javet alleine am Ufer des Grabens zurück. Während er wartete vertrieb er sich die Zeit damit, kleine Steine ins Wasser zu werfen. Er stellte fest, dass sie manchmal über die Wasseroberfläche sprangen, wenn sie besonders flach waren. Nach einer Weile hatte er herausgefunden, wie er werfen musste, damit die Steine noch weiter sprangen und machte eine Art Spiel daraus. Bestimmt hätte das Annie gefallen, dachte er auf einmal und fühlte wieder den schmerzenden Knoten in seiner Brust. Die untergehende Sonne sah in der Reflexion irgendwie verzerrt und verschwommen aus. Bald war das Licht vollkommen gewichen und nun spiegelten sich der Halbmond und die unzähligen Sterne im schwarzen Wasser.
Auf einmal ergriff seine Hand einen ungewöhnlich glatten Stein, der für seine Größe auch irgendwie viel zu leicht war. Verwirrt hob er ihn hoch und führte ihn, statt ihn ins Wasser zu werfen, näher an seine Augen. Wegen der Dunkelheit konnte er nicht viel erkennen, aber war das ein orangener Schimmer in dem Stein? Er erinnerte sich an die Beschreibungen von Bernstein, die er manchmal gehört hatte. Vorsichtshalber steckte er ihn in seine Hosentasche.
Javet fuhr ein kalter Schauer über den Rücken. Er war bereits müde, aber er konnte nicht einschlafen. Durfte nicht, wollte nicht. Er wusste, dass ihn dann wieder ein Albtraum erwarten würde. Wie der, in dem er unermüdlich Steine für Annies Grab einen Berg hinauf schleppte. Wo bleibt Domador nur? Ist ihm etwas passiert? Sollte ich ihm folgen?
Irgendwann musste er doch eingeschlafen sein, denn als er aufwachte, schien die Sonne ihm direkt ins Gesicht. Und wurde gleich darauf verdeckt von einem schwarzen Pferdekopf. Javet erschrak und fuhr hoch. Im ersten Moment hatte er gedacht, eines der Höllenrösser würde ihn neugierig mustern, aber das Tier hatte einen vollständigen und gesunden Kopf.
»Er heißt Sult, wenn ich es richtig verstanden habe«, ertönte Domadors Stimme. Der Mann nahm den Hengst bei den Zügeln und führte ihn ein Stück zurück, damit Javet in Ruhe aufstehen konnte. »Das einzige Pferd, das im Stall deines Fährmanns überlebt hat. Es hat sich aber kaum jemand um ihn gekümmert. Ich musste ihn erstmal füttern und ihm Wasser geben, bevor ich losreiten konnte. Deswegen hat es so lange gedauert.« Er winkte Javet zu sich. »Komm, brechen wir auf.«
Sie ritten, sich an der Sonne orientierend, immer weiter nach Süden, in Richtung Westland. Keine Menschenseele und kein Untier kreuzten ihrem Weg. Nicht mal Wasserhändler begegneten ihnen. Nur ein Mal sahen sie aus weiter Ferne einen Wagen, der sich durch die kahle Einöde kämpfte.
Dass sie das Nordland verlassen hatten, erkannte Javet erst, als sie auf das erste Dorf trafen. Hier wurde eine Sprache gesprochen, die ihn unheimlich an die der Triglaza erinnerte. Aber es war offensichtlich, dass die Menschen hier nicht zu ihnen gehörten. Schließlich hatten sie keine zweite Haut – keine Anzüge, wie der Zar sie genannt hatte – und auch die Stirnbänder fehlten. Eine Frau, die sie auf der Straße entdeckte, sprach sie kurz in einer anderen Sprache an, die nur aus Zischlauten und Vokalen zu bestehen schien. Javet verstand kein Wort.
»Wir möchten nach Chengbao«, sagte er auf Nordländisch. Die Frau schaute ihn verständnislos an. Wir bin also wirklich im Westland angekommen. Seltsam, dass es keine Wachen an den Grenzen gab.
»Sag ihr den Namen nochmal langsam«, schlug Domador vor, während er Sults Zügel festhielt. Sie waren am Eingang des Dorfes abgestiegen, um auf der schmalen Straße keine Menschen umzureiten.
»Chengbao«, wiederholte Javet also langsamer.
Diesmal schien die Frau zu verstehen. Sie nickte, bedeutete ihnen, zu warten, und rief jemanden zu sich, der in einiger Entfernung am Straßenrand stand und mit zwei aneinander gebundenen Löffeln abwechselnd gegen seine Hände und Oberschenkel schlug. Der junge Mann schaute auf und rannte zu der Frau, die ihn sogleich weg schickte. Wenig später tauchte er mit einem Stück Pergament und einem Stift wieder auf. Er reichte beides der Frau, die einige Linien darauf zeichnete. Als sie fertig war, reichte sie das Schriftstück Domador, der es Javet zeigte. Die Frau deutete auf einen Punkt, den sie mit Buchstaben beschriftet hatte, die er nicht kannte.
»Chengbao«, sagte sie. Ihr Finger wanderte zu einem Kreuz weiter oben auf der flüchtig gezeichneten Karte. »Rodina.« Sie fügte etwas in ihrer Sprache hinzu und zeigte mit beiden Händen um sich herum.
»Dieses Dorf heißt Rodina«, verstand Javet. »Und Chengbao ist südlicher.« Er warf einen weiteren Blick auf die Karte, rollte sie schließlich zusammen und lächelte der Frau freundlich zu. »Danke.«
Sie lächelte ebenfalls und winkte ihnen zum Abschied zu. Nachdem sie das Dorf verlassen hatten, versuchten sie, sich an der Karte zu orientieren, was jedoch schwerer war als erwartet. Sie wussten nur, dass sie weiter nach Süden mussten, folgten also dem höchsten Stand der Sonne.
In der wüsten Leere des Pazifiks machten Domador und Javet sich nicht die Mühe, sich für die Nacht irgendeinen besonderen Unterschlupf zu suchen. Vielleicht war das ein Fehler. Sie spielten sehr mit ihrem Glück, doch diesmal schien es auf ihrer Seite zu stehen. Weder Räuber noch Sklavenhändler oder sonstige unangenehme Reisende kreuzten ihren Pfad. Wie immer war es leblos. Dennoch waren sie wachsam. Nachts hielten sie immer abwechselnd Wache und wenn die Gelegenheit sich bot, übernachteten sie in einem Wrack, von denen Marielle Javet erzählt und die er auf seiner Reise nach Hölle bereits gesehen hatte. Zwar konnte er die Sterne dann nicht sehen, aber mittlerweile machte das keinen Unterschied mehr. Die Alpträume quälten ihn trotzdem, unabhängig von seinem Schlafplatz. Und sie wurden immer schlimmer. Aber er erzählte Domador nichts davon. Das würde sie nicht verschwinden lassen, das wusste er.
Nach vier Tagen erreichten sie ein weiteres Dorf, das jedoch eher wie ein Stützpunkt für Krieger aussah. Hohe Steinmauern umringten die Häuser, deren Dächer seltsam spitz aussahen. Männer in Leder- oder Metallrüstungen patrouillierten auf den Mauern. Als sie sich dem Tor näherten, rief einer der Soldaten etwas zu ihnen hinunter. Sofort hielt Domador Sult an und hob die Hände als Zeichen des Friedens. Javet tat es ihm nach und blickte zu dem Mann auf, damit dieser seine dunkle Hautfarbe sehen und sich denken konnte, dass er kein Westländisch verstand, weil er aus dem Ostland kam. Wie erhofft lachte der Krieger auf und rief etwas, woraufhin das Tor sich öffnete.
Im Dorf eilten viele Menschen hin und her. Javet fiel auf, dass praktisch alle schwarze Haare hatten, doch ihre Haut war sogar noch blasser als die der Nordländer. Die Frauen schienen sich ihre Gesichter teilweise sogar weiß angemalt zu haben. Einige hatten sich ihre Haare mit einer Klammer oder Nadel hochgesteckt und die weiten Ärmel ihrer kostbar aussehenden Kleider reichten fast bis zum Boden. Die Männer hingegen schmückten sich mit prächtigen Rüstungen, in die teilweise funkelnde Edelsteine eingelassen waren.
Fasziniert ging Javet neben Domador und Sult durch die Straßen. Allmählich bekam er das Gefühl, dass das Westland von allen Ländern des Pazifiks das reichste sein musste. Wenn selbst die Menschen im Dorf sich so kleiden! Wenn dies hier wirklich ein Dorf ist! Viele Passanten warfen ihnen seltsame Blicke aus ihren schmalen, mandelförmigen Augen zu, doch Javet ignorierte sie. Einem spontanen Impuls folgend ging er geradewegs zu einem Stand, an dem ein Mann Schmuck verkaufte. Als Javet bei ihm ankam, hob dieser verwundert den Kopf und fragte etwas auf Westländisch.
Statt einer Antwort zog Javet den Stein aus seiner Hosentasche, den er an dem Graben mit dem giftigen Wasser gefunden hatte. Er hatte seine Existenz vergessen, bis er die funkelnden Rüstungen der Krieger hier gesehen hatte. Wenn es wirklich ein Bernstein war... Es schadete sicher nicht, ihn zu verkaufen, um später Geld zu haben, mit dem sie weiteren Proviant kaufen konnten, sollte das nötig sein. Jetzt, bei Tageslicht, konnte Javet sehen, dass der Stein wirklich leicht orange war. Allerdings war er sehr trüb und schien irgendwie schmutzig zu sein, wobei man den Schmutz aber nicht mit den Fingern abrubbeln konnte.
»Was ist das?«, fragte Domador verwundert, der neben ihn getreten war, Sult weiterhin an den Zügeln.
»Ich bin mir nicht sicher«, antwortete Javet. »Ich habe ihn gefunden. Wenn es ein Bernstein ist, ist er sehr wertvoll. Dann haben wir genug Geld, um notfalls Proviant zu kaufen und vielleicht auch, um mir noch ein eigenes Pferd zu besorgen.« Er deutete zu Sult. »Immerhin ist es anstrengend, immer zwei Reiter tragen zu müssen.«
Javet zeigte seine geöffnete Handfläche mit dem Stein dem Mann, dessen Augen sich bei diesem Anblick so stark weiteten, dass er glaubte, sie müssten ihm gleich ausfallen. Keuchend streckte er die Hände aus als wolle er ihn Javet wegnehmen, atmete dann jedoch tief durch und fing an, wild auf ihn einzureden. Er wurde immer verzweifelter, bis er es schließlich aufgab und einfach ein Stück Pergament herausholte, auf den er eine Zahl schrieb.
»Tausend«, las Javet. »Was tausend? Ich möchte diesen Stein verkaufen.«
Der Mann schlug verzweifelt die Hände vors Gesicht, schüttelte fassungslos den Kopf und fügte eine Null hinzu.
»Zehntausend?« Javet runzelte verwirrt die Stirn. »Hör zu, ich möchte den Stein nur verkaufen. Wie viel...?«
Der Mann malte eine weitere Null dazu.
Und da erst begriff Javet. So viel ist dieser Stein wert? Ist es also wirklich ein Bernstein? Er blickte den Mann sprachlos an und verkniff sich ein erheitertes Lachen. Er möchte diesen Stein so sehr haben, dabei gibt es auch Sachen, die man sich nicht mit Münzen kaufen kann. Zum Beispiel das Leben einer anderen Person.
»So viel ist der Stein wert?« Domador versuchte, seine Stimme ruhig klingen zu lassen, aber das Misstrauen war ihm anzusehen. »Wir sollten noch jemand anderen fragen. Vielleicht betrügt der Mann dich.«
»Nein, ist schon in Ordnung«, widersprach Javet. Kurzerhand nahm er dem Mann den Stift aus der Hand, strich die letzten drei Nullen durch Zahl durch und malte stattdessen ein Pferd daneben. Er tippte mit dem Finger auf die neue Zahl und die Zeichnung und dann auf den Stein. »Ich möchte nur hundert Münzen und ein Pferd haben«, sagte er und deutete zwischen ihnen beiden hin und her. »Tauschen.«
Der Mann starrte ihn mit offenem Mund an, war für einige Augenblicke erstarrt, nickte dann jedoch wie wild. Er holte einen dicken Geldbeutel unter seinem Stand hervor, den er Javet mit einer Vielzahl an Verbeugungen und respektvollen Handgesten überreichte. Gleichzeitig rief er etwas in das Haus hinter sich. Eine Frau, die wie ein Dienstmädchen aussah, tauchte auf. Ihre Haare waren von einem dunklen Braun und auch ihre Augen waren eher rund wie die der Menschen in Rodina. Nachdem sie sich angehört hatte, was der Mann zu sagen hatte, verschwand sie die Straße hinunter und kehrte schließlich mit einem Hengst zurück, dessen Fell im Licht der Sonne aussah, als würde es brennen. Er war bereits vollkommen aufgezäumt und gesattelt. Der Mann klatschte begeistert in die Hände, scheuchte das Dienstmädchen weg und führte den Hengst den Rest des Weges zu Javet. Er grinste den Jungen zufrieden an und streckte auffordernd die Handfläche aus. Ohne lange zu überlegen, ließ Javet den Stein hinein fallen, der sofort in einer der Taschen des Mannes verstaut wurde.
»Hong Tuzi«, sagte dieser nun überdeutlich und deutete auf den Hengst. »Hong Tuzi.«
»Der Hengst heißt Hong Tuzi?«, vermutete Javet. »Danke.«
Er überließ den Mann seiner Freude über den neu errungenen Stein und nahm den feurigen Hengst an den Zügeln.
»Ich bin mir sicher, wir hätten noch mehr Geld verlangen können«, ließ sich Domador vernehmen. Er sah nicht zufrieden aus, sagte jedoch nichts, als Javet sich auf den feuerroten Hengst stieg.
»Reiten wir weiter.« Javet befestigte den Geldbeutel an seinem Gürtel und stieß dem Hengst die Fersen in die Seite. Hong Tuzi wieherte laut auf und sprang dann nach vorne. Bald darauf hörte er hinter sich auch das Hufgetrappel von Sult.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top